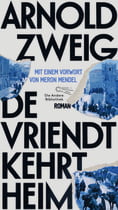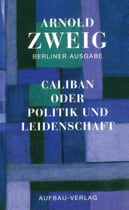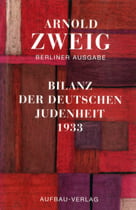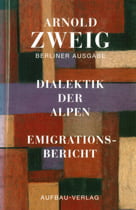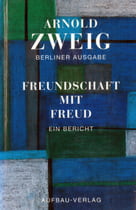Ein 100 Jahre zurückliegender Mord und die Wurzeln des Nahostkonflikts

»Knapp zwanzig Jahre vor dem Weltkrieg hat sie [die Juden] ein österreichischer Schriftsteller namens Herzl … zur Rückkehr aufgerufen …: ›Jetzt ist die Stunde, Israel! Volk ohne Land, erlöse das Land ohne Volk.‹ Und dabei wohnten damals schon dreihunderttausend Araber darin, aber das wusste er glücklicherweise nicht.«
(Arnold Zweig, De Vriendt kehrt heim, S. 109)
Auszug aus dem Vorwort von Meron Mendel
Mit dem 7. Oktober 2023 rückte plötzlich und mit Wucht der Nahostkonflikt zurück ins Zentrum der Weltaufmerksamkeit. Die Bilder des Massakers an israelischen Zivilisten in den Kibbuzim und auf dem Supernova-Musikfestival sowie die darauffolgende Zerstörung des Gazastreifens führten die Grausamkeit des langjährigen Konflikts vor Augen. Das Massaker am 7. Oktober war das größte, aber nicht das erste in der Geschichte der beiden Bevölkerungsgruppen. Als Arnold Zweig vor etwa 90 Jahren das britische Mandatsgebiet Palästina besuchte, war die jüdische Bevölkerung gerade durch das Massaker vom August 1929 erschüttert worden. Ein Massaker, das mehreren hundert Jahren des weitgehend friedlichen Zusammenlebens von Juden und Arabern in Hebron, Safed und Gaza ein blutiges Ende bereitete.
Einen Monat nach seiner Rückkehr aus Palästina veröffentlichte Zweig mit De Vriendt kehrt heim 1932 ein denkwürdiges Dokument seiner Zeit, das bis heute von brisanter Aktualität ist. Zweig selbst bezeichnete sein Buch später, im Nachwort zur Ausgabe von 1955, als »den ersten historischen Roman des Staates Israel«. Er ist zugleich eine fiktionalisierte Dokumentation des ersten politischen Mordes in der Geschichte des Zionismus. Wie nun erneut im Oktober 2023, so hat auch das Massaker von 1929 existenzielle Fragen für Juden im Land Israel aufgeworfen:
»Hat die Idee von einer jüdischen Souveränität inmitten des Nahen Ostens eine Zukunft? Können die zwei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen der Juden und Araber auf einem schmalen Streifen Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss nebeneinander und miteinander friedlich zusammenleben? Werden sich die zwei Nationalbewegungen jemals auf einen Kompromiss einlassen?«
Arnold Zweig behandelt in seinem fiktionalen Werk den Mord an dem niederländischen Juristen und Schriftsteller Dr. Jacob Israël de Haan, der sich 1924 in Jerusalem ereignete. Es war der erste politische Mord in der Geschichte der Jischuv, der jüdischen Bevölkerung in Palästina vor der Staatsgründung Israels. Zweig datiert die Bluttat im Roman auf das Jahr 1929 um, sodass er direkt vor dem Hintergrund der Verschärfung des jüdisch-arabischen Konflikts stattfindet. In der israelischen Geschichtsschreibung wurde der reale Mord bis heute nicht aufgearbeitet – wie auch der Roman in Israel weithin unbekannt geblieben ist. Denn de Haan verkörperte wie kaum ein anderer das Gegenteil des zionistischen Ideals: Er war überzeugter Antizionist, der seine Positionen nicht nur öffentlich in Zeitungsartikeln, sondern auch in Gesprächen mit arabischen und britischen Politikern zum Ausdruck brachte. Unter anderem traf er sich mit dem Emir Abdallah ibn Husain, dem späteren König von Jordanien, und mit dem britischen Hochkommissar Herbert Samuel.
Seine ideologische Heimat fand de Haan stattdessen ausgerechnet bei der ultraorthodoxen Gemeinschaft in Jerusalem. Dort wurde er zum engen Vertrauten von Großrabbiner Joseph Sonnenfeld (im Roman heißt er Rabbiner Zadok Seligmann). Der dezidierte Antizionismus dieser Ultraorthodoxen begründet sich aus der jüdischen Theologie: Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer und das daraufhin erzwungene Exil des jüdischen Volkes werden als Strafe Gottes interpretiert. Eine jüdische nationale Souveränität kann und darf demnach erst dann wieder hergestellt werden, wenn der Messias gekommen ist. Das Projekt der Zionisten erscheint aus diesem Blickwinkel gotteslästerlich.

Wie auch sein Freund, der Religionsphilosoph Martin Buber, vertrat Zweig die Auffassung, dass Juden und Araber gleichberechtigt in einem binationalen Staat leben sollten. Nach seiner erzwungenen Auswanderung 1934 nach Haifa (von Berlin über Prag und Sanary-sur-Mer) verließ Zweig der Glaube an die jüdische Nationalbestrebung endgültig. Er ging zunächst ins innere Exil, bevor er, in Palästina immer fremd geblieben, 1948 nach Ostberlin zurückkehrte; bis zu seinem Tod 1968 lebte er in der DDR. In de Haan erkennt Zweig den Schlüssel zum Verständnis der Dilemmata, die ihn den Rest seines Lebens begleiteten:
»Ich wusste, er würde mich in die Tiefe jüdischer und menschlicher Problematik hineintragen; nur ahnte ich nicht, wie tief.«
Zweig war von der Vielschichtigkeit, der schieren Widersprüchlichkeit seiner Hauptfigur angezogen: ein niederländischer Marxist, der zum ultraorthodoxen Juden wurde. Ein Dichter und Schriftsteller, der über sein gleichgeschlechtliches Begehren schrieb. Ein westeuropäischer Intellektueller inmitten der osteuropäischen ultraorthodoxen Gemeinde Jerusalems. Ein Jude, der für einen arabischen Jungen mehr als nur Lehrer war. Ein Pragmatiker und Ideologe zugleich.
Das tragische Ende von de Haan steht für Zweig metaphorisch und konkret politisch für die Sackgasse, in der er selbst sich Anfang der 1930er Jahre befindet.
Jacob Israël de Haan vertrat die Position, die Juden in Palästina sollten in einem arabischen Staat als eine Minderheit mit religiösen, aber nicht mit nationalen Rechten anerkannt werden. Das ließ sich nicht realisieren. Aber auch die zionistische Vorstellung »Volk ohne Land, erlöse das Land ohne Volk« erwies sich als eine bequeme Illusion. Neunzig Jahre später leben im eng begrenzten Raum zwischen dem Mittelmeer und dem Jordanfluss sieben Millionen Juden und sieben Millionen Palästinenser, deren aller Leben aufs Tiefste vom ungelösten Konflikt geprägt ist.
Die nun vorliegende Neuausgabe macht De Vriendt kehrt heim für neue Leserinnen und Leser im deutschsprachigen Raum zugänglich. 90 Jahre nach der Erstveröffentlichung ist die Lektüre erstaunlich frisch und deprimierend zugleich.
»Der Roman ist das Dokument der longue durée des Nahostkonflikts.«
So viel ist seitdem passiert. Und doch haben sich die Grundkoordinaten des Konflikts so wenig geändert. Es bleiben zwei Völker, die miteinander oder nebeneinander zu leben verdammt sind.
Es bedarf einiger Wunder, um den Konflikt endlich zu beenden. Aber wie schon David Ben-Gurion, der erste israelische Ministerpräsident, konstatierte: »Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist!«