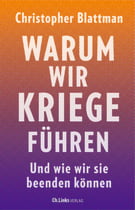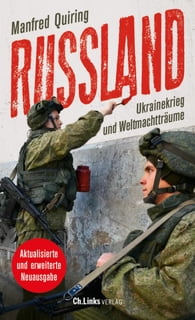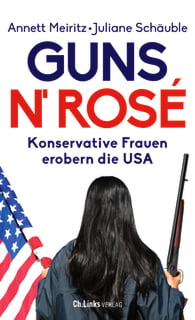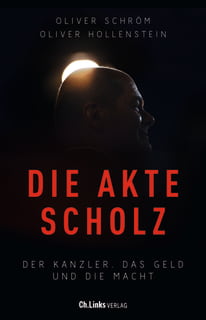»Warum wir Kriege führen«: Christopher Blattman im Interview

Herr Professor Blattman, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Kriegen und gewaltsamen Konflikten. Welches Missverständnis begegnet Ihnen am häufigsten, wenn es um die Ursachen von Kriegen geht?
Viele Menschen glauben, Krieg sei der Naturzustand des Menschen. Dass er allgegenwärtig sei. Aber das stimmt nicht. Die meiste Zeit kämpfen wir überhaupt nicht. Ich drücke es gern so aus: Selbst Feinde pflegen ihre gegenseitige Verachtung lieber auf friedliche Weise.
Das mag etwas merkwürdig klingen, weil wir doch gerade einen massiven Konflikt in der Ukraine erleben. Aber ich würde sagen, dieser Eindruck entsteht, weil wir nur von Auseinandersetzungen Notiz nehmen, die tatsächlich stattfinden, aber nicht von denen, zu denen es gar nicht erst kommt.
Zwei Wochen vor Russlands Einmarsch in die Ukraine feuerte zum Beispiel Indien versehentlich einen Marschflugkörper auf Pakistan ab. Was folgte, war besonnenes Handeln. Die Kosten eines Krieges wären so unvorstellbar hoch gewesen, dass beide Seiten alles unternahmen, um ihn zu verhindern. Und genau das tun sie seit Jahrzehnten.
Selbst Putin hat auf die ihm eigene heimtückische Art und Weise versucht, um einen Krieg herumzukommen. Zwanzig Jahre lang hat er alle möglichen verdeckten Mittel verwandt, um die Ukraine in seinen Machtbereich einzugliedern: Schwarzgeldzahlungen, Propaganda, politische Strohmänner, Mordanschläge, Unterstützung für Separatisten. Er hat also erst einmal alles Mögliche ausprobiert, denn so kostspielig diese Dinge auch waren und so viel Gewalt dabei auch im Spiel war, nichts davon ist so risikoreich und ruinös wie ein Krieg.
Das Problem ist, dass niemand ein Buch über die Phasen schreibt, in denen nicht gekämpft wird. Über all die Kompromisse, die im Stillen geschlossen werden, sehen wir hinweg. Wir sind gewissermaßen wie Ärzte, die immer nur schwerkranke Patienten zu sehen bekommen und keine Ahnung haben, wie eigentlich der gesundheitliche Normalzustand aussieht. Das zieht einige negative Konsequenzen nach sich. Eine davon ist, dass solche Ärzte womöglich eine falsche Diagnose stellen werden und irgendeine furchtbare Behandlung verordnen.
In ihrem Buch »Warum wir Kriege führen« haben sie fünf allgemeine Kriegsursachen ausfindig gemacht. Dem »Wall Street Journal« zufolge wurden die Thesen Ihres Buches durch Wladimir Putins Invasion in die Ukraine »auf makabre Weise einem Realitätstest unterzogen« – und diesen Test hätten sie bestanden. Könnten Sie die fünf Ursachen am Beispiel dieses Krieges erläutern?
»Unkontrollierte Interessen«
Den ersten Grund nenne ich »unkontrollierte Interessen«. Wenn Sie an Wladimir Putin denken, so kann er die meisten Kosten ignorieren, weil er sich vor den Menschen, die diese tragen müssen, nicht verantworten muss. Autokraten wie er können ihre privaten Interessen verfolgen. Weil sie sich nur um den Bruchteil der Kosten kümmern müssen, der ihnen selbst entsteht, wenden sie allzu leichtfertig Gewalt an.
»Immaterielle oder ideologische Anreize«
Den zweiten Grund nenne ich »immaterielle oder ideologische Anreize«. Putins imperiale Obsessionen sind ein Beispiel dafür – das Streben nach »make Russia great again«, nach persönlichem Ruhm oder einem Platz in den Geschichtsbüchern. Zwar ist ein Krieg immer noch kostspielig und riskant für ihn (auch wenn er ein Diktator ist), aber für solche Anreize ist er bereit, diesen Preis zu zahlen.
»Ungewissheit«
Der dritte Grund ist »Ungewissheit«. Wir müssen uns nur ins Gedächtnis rufen, über was alles wir uns noch vor einigen Monaten im Unklaren waren: die Tapferkeit und Entschlossenheit der Durchschnittsukrainer:innen, die militärische Stärke Russlands, die Geschlossenheit des Westens in der Sanktionsfrage. Wenn die Situation derart unklar ist, liegt man mit seiner Kosten-Nutzen-Kalkulation schnell daneben. Niemand hätte erwartet, dass all diese Faktoren zu Russlands Ungunsten ausfallen würden – am allerwenigsten Putin selbst. Krieg ist eben teilweise auch ein Glücksspiel.
»Wahrnehmungsfehler«
Den vierten Grund bezeichne ich als »Wahrnehmungsfehler«. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir bei vielen Dingen im Dunklen tappen, sondern wir verarbeiten die Informationen, die wir bekommen, auch noch auf eine voreingenommene oder verzerrte Weise. Die ganzen Geschichten darüber, wie abgeschottet Putin ist, dass er die eigenen Möglichkeiten überschätzt und die Kosten des Krieges unterschätzt — letztlich geht es dabei um Wahrnehmungsfehler.
»Selbstbindungsproblem«
Der fünfte und letzte Grund ist ein strategisches Konzept, das als »Selbstbindungsproblem« bezeichnet wird. Ein solches liegt vor, wenn eine Seite nicht darauf vertrauen kann, dass die andere sich an ein Friedensabkommen hält, und deshalb einen für sie vorteilhaften Status quo zu zementieren versucht, solange sie dazu noch in der Lage ist.
Dieser Grund lässt sich bei der russischen Invasion in die Ukraine nicht so leicht wiederfinden wie die anderen vier, aber ich will versuchen zu erklären, inwiefern er eine Rolle gespielt haben könnte. Die Ukraine hatte türkische Drohnen erworben und war dabei, eigene Abwehrraketen zu entwickeln. Eine Invasion wäre für Russland immer schwieriger geworden, und umgekehrt konnte sich die Ukraine schlecht darauf einlassen, auf Maßnahmen zum eigenen Schutz zu verzichten. Russlands Möglichkeiten, Druck auszuüben, waren damit wohl an einem Scheitelpunkt angelangt. Es galt »jetzt oder nie«.
Es gibt eine Sache, die ich natürlich klarstellen muss: Eine Aggression zu erklären heißt nicht, sie zu rechtfertigen. Nur weil es für Putin strategische oder ideologische Anreize für die Invasion gab, ist sie noch lange nicht gerechtfertigt.
Gibt es Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, den Krieg in der Ukraine in näherer Zukunft zu beenden? Was könnte funktionieren?
Die meisten Kriege sind kurz. Im letzten Jahrhundert dauerten sie im Schnitt nur 100 Tage. Leider ziehen sich einige Kriege länger hin, weil es strategische Gründe gibt weiterzukämpfen — es ist für beide Seiten immer noch das Beste, trotz der horrenden Kosten. Meiner Ansicht nach ist das auch hier der Fall, und deshalb gehe ich davon aus, dass der Krieg noch einige Zeit weitergehen wird.
Der erste strategische Grund lautet: Abschreckung durch Pflege der eigenen Reputation. Eine ganze Reihe westlicher Staats- und Regierungschefs macht sich Sorgen, dass jedes Zugeständnis der Ukraine Russlands völkerrechtswidrige militärische Aggression belohnen würde und ein Ansporn für künftige Diktatoren wäre. Russland nukleares Säbelrasseln verstärkt solche Sorgen noch. Wenn der Westen und die Ukraine nachgäben, wäre dies ein klares Signal an andere Staaten: Wenn ihr straflos davonkommen wollt, dann beschafft euch Atomwaffen. So gesehen liegt es im langfristigen Interesse der NATO, die Ukraine zu unterstützen und sie darin zu bestärken, den vollständigen Rückzug Russlands zu fordern.
Der zweite strategische Grund kommt zum Tragen, wenn keine der beiden Seiten glaubt, dass es für die jeweils andere einen Anreiz gibt, sich an ein Abkommen zu halten, so dass dieses gar nicht erst geschlossen wird. Es gibt also ein Selbstbindungsproblem, und zwar aus ideologischen Gründen. Russlands Glaubwürdigkeit leidet darunter, dass die Führung des Landes (oder die Bevölkerung) bereit sind, für Ruhm und Größe des Landes jeden Preis zu zahlen. Die Glaubwürdigkeit der Ukraine hingegen leidet, insofern die Bevölkerung eher kämpfen würde als Territorium oder die eigene Souveränität abzugeben.
Ich sehe drei Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Die eine ist ein langwieriger und brutaler Krieg, der möglicherweise auf den Osten und den Süden der Ukraine beschränkt wäre. Die zweite ist eine Pattsituation bei anhaltenden Spannungen. In diesem Fall würde aus dem Donbas eine Art Kaschmir, nur dass es wie bei vielen »eingefrorenen Konflikten« nach wie vor Kampfhandlungen gäbe, wenn auch mit niedrigerer Intensität. Die dritte und beste Möglichkeit besteht darin, dass sein Abkommen ausgehandelt wird, idealerweise eines, bei dem Russland sich aus dem Donbas zurückzieht. Allerdings glaube ich nicht, dass es in näherer Zukunft dazu kommt.
Gibt es eine Frage zum Buch, die Ihnen nie gestellt wird, die Sie aber gern beantworten würden?
Viele Menschen fragen mich »Was sollen wir jetzt tun?«, aber das ist die falsche Frage. Frieden zu schaffen stelle ich mir eher wie die Arbeit eines Arztes vor. Wenn die Leute mit einer Krankheit oder irgendwelchen Beschwerden zu Ihnen kommen, lassen Sie auch nicht alle gleich röntgen, geben ihnen Paracetamol und schicken sie wieder nach Hause. Vielmehr geben Sie sich zunächst einmal Mühe mit der Diagnose, und das in dem Bewusstsein, dass Sie auch daneben liegen können. Dann probieren Sie eine Therapie aus und prüfen sorgfältig, ob sie den erwarteten Effekt hat. Wenn nicht, war vielleicht die Diagnose falsch, und Sie beginnen nochmal von vorn.
Außerdem gibt es Menschen, die neue Medikamente und Behandlungsmethoden entwickeln. Sie versuchen zunächst, die tieferen Ursachen der Erkrankung zu verstehen. Dann denken sie sich etwas Neues aus – manchmal ist es vielleicht nur eine Kleinigkeit, die sie anders machen – und prüfen gründlich, ob es unbeabsichtigte Nebenwirkungen hat oder die Krankheit sogar verschlimmert. So ist es zu medizinischem Fortschritt gekommen: durch Abertausende kleiner Schritte von Ärzt:innen, Pflegepersonal und Labortechniker:innen.
Friedensarbeit spielt sich für mich genauso ab. Man macht dabei keine Riesensprünge durch irgendein revolutionäres neues Konzept, es gibt keine Standardverfahren (wie Röntgenlassen oder die Gabe von Paracetamol), mit denen sich jeder denkbare Konflikt beilegen ließe. Mit »Warum wir Kriege führen« versuche ich, den Leser:innen ein besseres Instrumentarium für eine sorgfältige Diagnose an die Hand zu geben: indem sie die Kosten eines Kriegs in den Blick nehmen, den Normalfall und die fünf Ursachen berücksichtigen. Ich hoffe, danach nehmen sie genauer wahr, was sich in ihrer Stadt, ihrer Community oder ihrem Land abspielt.
Übersetzung: Christof Blome